Es gibt keinen Abfall - nur Nahrung
Michael Braungart ist 64 Jahre alt. Er studierte in Konstanz und Darmstadt Chemie und Verfahrenstechnik. Nach seiner Promotion in Chemie an der Universität Hannover baute er den Bereich Chemie von Greenpeace Deutschland mit auf. Er gründete 1987 ein Umweltforschungs- und Beratungsinstitut und entwickelte zusammen mit William McDonough das Cradle-to-Cradle-Konzept. Seit 2008 ist er Professor für den Cradle-to-Cradle-Studiengang an der Erasmus-Universität Rotterdam. Es entstehen seither unter anderem Bürostühle und Schuhe, die verrotten können.
Herr Braungart, wir Deutschen gelten als Recyclingweltmeister. Seit diesem Jahr gibt es sogar ein Verpackungsgesetz, das vorschreibt, dass 63 Prozent des Verpackungsmülls recycelt werden muss. Was haben Sie denn gegen Recycling?
Die Dinge, die recycelt werden, sind nie für Recycling entwickelt worden. Das heißt, man macht das Falsche perfekt und damit perfekt falsch. Das ist immer Downcycling: Es ist noch nie eine Fensterscheibe wieder zur Fensterscheibe gemacht worden und ein Auto zum Auto. Es werden immer primitivere Produkte daraus: Straßenbeläge, Lärmschutzwände, Parkbänke… Die meisten Kunststoffe können nicht recycelt werden, weil die Kettenlänge der Moleküle bei jedem Recyclingprozess abbricht. Der Kunststoff wird immer minderwertiger. Auch den besten Verpackungskunststoff, PET, kann man höchsten achtmal verwenden. Ein Problem ist auch, dass Verpackungen oft aus Kunststoffmischungen bestehen.
In einem Produkt stecken dann mehrere Kunststoffe, sodass man sie gar nicht mehr richtig auseinander bekommt? Wie den Milchkarton?
Genau. Es gibt viele Verpackungen mit Beschichtungen, Schrumpffolie, dazu kommen rund 4500 verschiedene Pigmente und Additive wie UV-Stabilisatoren, Hitze- und Kältestabilisatoren… Das bedeutet immer Downcycling zu einem minderwertigeren Produkt.
Sie sagen auch: „Recycling ist innovationsfeindlich.“
Weil man ständig darüber nachdenkt, wie man das Falsche perfekt machen kann, anstatt gleich von vornherein bessere Verpackungen zu entwickeln. Eine Lösung: Pfand auf alle Kunststoffverpackungen, auch auf die von Salzstangen. Dann könnte man eine einheitliche Kunststoffsorte verwenden - etwa PET. Die könnte man dann wieder zurück gewinnen und neu einsetzen. Man bekäme dann eine Pfandkarte im Wert von 30 Euro, die für 120 Produkte reichte, ohne dass man mehr zahlen muss.
Man bringt ja jetzt schon seine PET-Flaschen in den Supermarkt, wo sie der Pfandautomat schreddert. Da funktioniert’s ja ganz gut, dass immer neue PET-Flaschen draus werden.
Bis zu achtmal zumindest. Aber danach ist die Kettenlänge zu kurz. 20 Prozent des Materials muss man jedes Mal ausschleusen. Aber daraus könnte man wunderbar Textilien machen. Sogar biologisch abbaubare. Man müsste das PET dann mit langkettigem, linearem Polyester versetzen. Das wäre auch wegen des vielen Mikroplastiks in den Ozeanen wichtig. Wir essen ja jede Woche so viel Mikroplastik wie eine Kreditkarte ausmacht. Wenn aber das mit Polyester versetzte PET im Meer landet, dann wäre das ein toller Plankton.
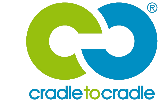 Was aber ist besser an Ihrem Konzept: Cradle to Cradle - übersetzt: Von der „Wiege zur Wiege“ statt „Von der Wiege zum Grab“?
Was aber ist besser an Ihrem Konzept: Cradle to Cradle - übersetzt: Von der „Wiege zur Wiege“ statt „Von der Wiege zum Grab“?
Es geht dabei nicht um vermeiden, sparen, verzichten, sondern ums nützlich sein. Nicht weniger schädlich. Die meisten denken, sie schützen die Umwelt, wenn sie weniger Schweinereien machen: Weniger Autofahren, kleinerer CO2-Fußabdruck, weniger Energie, weniger Wasser. Diese Logik bedeutet nur: weniger Zerstörung. Cradle to Cradle (C2C) aber denkt in Kreisläufen. Und davon haben wir zwei: einen biologischen und einen technischen. Dinge, die verschleißen - Schuhsohlen, Autoreifen, Bremsbelege, Verpackungen -, die müssen so gemacht werden, dass sie in biologische Systeme zurück gehen, dass sie kompostiert werden können.
Alle Dinge aber, die nur genutzt werden - Fernseher, Waschmaschine, Computer - werden so gemacht, dass deren Komponenten komplett in technische Kreisläufe zurück gelangen. Es geht bei C2C nicht um Abfallvermeidung. Wir sehen alles als Nährstoff, und zwar für Biosphäre oder Technosphäre. Wir haben zum Beispiel spezielle Schuhsohlen entwickelt, die sich komplett biologisch abbauen. Denn jeder Deutsche gibt im Schnitt 110 Gramm Mikroplastik allein durch Schuhabrieb ab. Selbst mit Firmen wie Puma kann man solche Dinge umsetzen.
Aber auch die Einzelteile eines technischen Gerätes werden doch immer minderwertiger, je länger man das Gerät nutzt…
Nein, nein, gar nicht. Eine Waschmaschine enthält etwa 80 Kunststoffe. Dabei setzt man an jeder Stelle den billigsten ein. Wenn man aber die Waschmaschine nicht mehr kauft, sondern nur 3000 Mal Waschen, dann kann der Hersteller das beste Material verwenden und statt 80 Kunststoffen sind in dieser Waschmaschine dann nur noch vier Kunststoffe drin. Und diese Kunststoffe lohnt es sich, wieder zurück zu gewinnen. Beispiel Teppichboden: Ein holländischer Hersteller verkauft keinen Teppich mehr, sondern eine Fußbodenverpackungsversicherung für zehn Jahre. Da weiß der Kunde: Dieser Teppich bleibt zehn Jahre lang schön. Denn der Hersteller kann ja die besten Materialien einsetzen, niemand braucht Teppichböden aus Plastik. Der Teppichbodenhersteller kann Teppichböden machen, die Feinstäube an sich binden und so die Luft reinigen. Es gibt auch eine Firma, die Terrassenfließen herstellt. Die verkauft nur noch dreißig Jahre Nutzung. Man kauft die Nutzung - nicht das Produkt, das bleibt Eigentum des Herstellers.
Baut der Hersteller dann die hochwertigeren Bauteile so zusammen, dass er sie später einfacher auseinander bekommt?
Ja! Und noch was: Hersteller sollten Teile nicht mehr zusammen schweißen oder schrauben, wie beim Auto. So nimmt die Passgenauigkeit von Mal zu Mal ab. Kleben ist besser. Wenn man dann das Auto nach zehn Jahren zurück gäbe, käme es in ein Tauchbad und Enzyme fräßen die Klebstoffe auf. Die Komponenten könnte man anschließend, wie bei einem Legoauto, neu zusammen setzen.
Aber zurück zu den Terrassenfliesen: Die gibt man dann auch nach dreißig Jahren zurück?
Nein. Man hat dreißig Jahre lang das Nutzungsrecht , kann das aber natürlich verlängern. Gefallen sie einem nicht mehr, gibt man sie an den Hersteller zurück und spart sich auch die Kosten für eine Entsorgung. Beispiel: Fenster. Man verkauft kein Fenster mehr, sondern die Nutzung. Ein Fensterhersteller verkauft ja in Deutschland 70.000 Tonnen Aluminium. Aber kein Kunde braucht Aluminium. Wenn nur die Nutzung verkauft wird, ist das Unternehmen im Jahr 200 Millionen Euro reicher.
Das Unternehmen zahlt nicht drauf?
Im Gegenteil. Der Kunde ist seine Materialbank. Das Unternehmen ist nicht mehr abhängig von chinesischem Material und Lieferengpässen. Es hat sein Material einfach für bestimmte Zeit bei jemandem geparkt. Es muss dann aus dem zurück erhaltenen Material auch nicht dasselbe Produkt werden. Heute kann es ein Bodenbelag sein, morgen Teil einer Waschmaschine, übermorgen in einem Auto verbaut sein. Wir werden in 10 bis 15 Jahren unseren gesamten Maschinenbau verlieren, wenn Unternehmen ihre Geschäftsmodelle nicht ändern. Auch weil man per 3D-Drucker in Zukunft schnell Geräte nachdrucken kann.
Lebten wir in einer kompletten Cradle-to-Cradle-Welt, könnten wir also in Saus und Braus leben. Wunderbar!
Wir sind von Natur aus nicht raffgierig, das sind wir nur, wenn wir Angst haben, dass nicht genug für uns da ist. Wir brauchen aber nicht alles besitzen, nutzen reicht uns auch.
„Alles ist nützlich statt schädlich. Je mehr du kaufst, desto besser.“ Mit solchen Sätzen provozieren sie. Am meisten vermutlich den Postwachstumkritiker Niko Paech. Er ruft stets zum Verzicht auf. Hat der bei Ihnen schon angerufen und gesagt, Sie sollen Ruhe geben?
Es gibt Leute, die sich gerne quälen. Die in Passivhäusern leben zum Beispiel. Ich will den Leuten nichts vorschreiben. Wenn jemand im Schmerz Lust empfindet, soll er das gerne tun. Weniger schlecht zu sein, reicht halt einfach nicht - für „weniger schlecht“ sind wir zu viele. Selbst wenn wir wie Niko Paech unseren Lebensstandard halbieren würden, wären wir immer noch zu viele. Dann würde der Planet halt ein bisschen später zugrunde gehen. Mir geht es nicht darum, möglichst viel zu kaufen, sondern zu sagen: Lasst uns überlegen, wo wir in zehn Jahren sein wollen.
Wenn ein Kunststoffhersteller das Ziel formuliert, in zehn Jahren nur noch Kunststoff aus dem CO2 der Atmosphäre zu machen, dann wäre das Kaufen von normalem Plastik geeignet, ihm zu helfen, das Geld zu verdienen, seine Produktion zu ändern. Dann ist der Kunde sein Freund. Traditionelle Nachhaltigkeit macht den Kunden aber zum Feind, denn sie sagt ihm: Bitte kauf’s erst gar nicht. Damit hängt der Hersteller aber mit dem jetzigen Produkt fest. Wenn er aber Profit macht und sein Produkt mit dem Geld ändern kann, freue ich mich auch über das Wachstum des Unternehmens. Und wenn man Leuten nur die Dienstleistung verkauft, wäre selbst der Kauf eines Diesel-SUV ein Beitrag, dem Autokonzern das Geld zu verschaffen, das Produkt zu verbessern.
Wie kommt Ihr Ansatz bei der Industrie an?
Meine größten Feinde in den Unternehmen sind die Nachhaltigkeits-Beauftragten. Die wollen nichts ändern, die schließen zwei weitere E-Autos auf dem Firmenparkplatz an, drucken Berichte auf Altpapier und machen die Plastikflaschen leichter. Das mittlere Management ist von meinen Ideen nicht begeistert, weil die eh schon genug Stress haben. Aber das Top-Management schätzt sie über die Maßen. Die laden mich ein. Die treibenden Kräfte aber bei C2C sind die Familienunternehmen. Das schwäbische Bauunternehmen Würth baut sich gerade zielstrebig in Richtung C2C um. Es gibt inzwischen über 16.000 C2C-Produkte auf dem Weltmarkt. Alle Designschulen, die etwas auf sich halten, lehren heute das Konzept. Wenn die Geschwindigkeit so bleibt, wird noch vor 2050 alles Cradle-to-Cradle sein. (Anm. d. Red.: Dann ist Michael Braungart 92 Jahre alt).
Isabella Hafner
